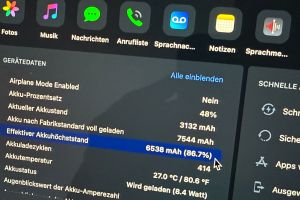Klimafinanzen in der Sackgasse: UN-Klimakonferenz in Bonn ohne Durchbruch
Die zehntägige UN-Klimakonferenz in Bonn endete ohne einen entscheidenden Fortschritt in der Frage der Klimafinanzierung. Zwar gelang es, den Beschlussentwurf von 65 auf 35 Seiten zu kürzen, doch spiegeln diese Seiten im Wesentlichen nur die Maximalforderungen beider Seiten wider.
Das Ziel, dass Industrieländer jährlich Milliardenhilfen für Klimaschutzmaßnahmen ärmerer Länder bereitstellen sollen, existiert seit 2009 und wurde 2015 im Pariser Klimaabkommen bis 2025 verlängert. Im Jahr 2022 wurde erstmals die Zielmarke von 100 Milliarden US-Dollar jährlich erreicht. Die aktuelle Ungewissheit betrifft nun die Zeit nach 2025. Ein konkreter Beschluss soll auf der kommenden Weltklimakonferenz im November in Baku (COP29) gefasst werden. In Bonn sollten dazu vorbereitende Schritte erfolgen.
Industrieländer fordern, dass auch die wohlhabenden arabischen Länder künftig zur Klimafinanzierung beitragen, da sie einerseits maßgeblich zur Klimabelastung beitragen und andererseits den finanziellen Spielraum dazu haben. Jan Kowalzig, Klimaexperte von Oxfam, kritisierte die Industrieländer scharf für ihre Bestrebungen, ihre bestehenden Verpflichtungen zu reduzieren. Kowalzig forderte, dass zur Vorbereitung eines robusten Beschlussentwurfs in Baku die Verhandlungen auf Ministerebene fortgeführt werden müssen. Er warnte davor, dass ein zu spätes Handeln der aserbaidschanischen COP-Präsidentschaft das Scheitern der Konferenz an der Finanzierungsfrage riskieren könnte.
David Ryfisch von Germanwatch teilte diese Besorgnis und erklärte, der Fortschritt bei den Verhandlungen sei bislang zu gering, um einen sinnvollen Kompromiss beim Weltklimagipfel zu erreichen. Er appellierte, dass die aserbaidschanische Präsidentschaft nun entschlossen handeln müsse, da nur Minister politische Konflikte dieser Art lösen könnten. Bis dahin würden die Delegierten weiterhin ohne klare Positionen agieren.
Parallel zur Konferenz wurden alarmierende neue Daten zur globalen Erwärmung präsentiert. Der EU-Klimawandeldienst Copernicus berichtete, dass seit einem Jahr jeder Monat weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen sei. Der Mai war der zwölfte Rekordmonat in Folge und lag 1,52 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die durchschnittliche globale Temperatur der letzten zwölf Monate von Juni 2023 bis Mai 2024 erreichte ebenfalls einen Höchstwert von 1,63 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt. (eulerpool-AFX)