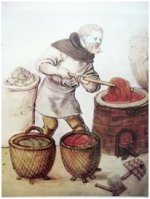raptor230961
Well-known member
- 24 Juli 2016
- 4.582
- 5.833
„ Aus dem Nähkästchen plaudern“
Bedeutung: Man verrät ein Geheimnis.
Herkunft: Früher war alles so ausgelegt, daß es für die männliche oder weibliche „Rolle“ ausgelegt war. Der Mann ging arbeiten, die Frau blieb zu Hause und sorgte für das Heim, die Küche und die Kinder. Während die „ungeschickte“ Frau niemals etwas im Haus reparierte (die „Aufgabe“ des Mannes) interessierte den Mann nicht die Küche und die Handarbeiten der Frau. Den Mann interessiert das Nähkästchen der Frau ebenso wenig, wie der Frau der Werkzeugkasten des Mannes. Der Unterschied: Betrog der Mann die Frau war das normal - nur wieder ein Zeichen dafür, was für ein toller "Hecht" der Mann war. Betrog aber die Frau den Mann hatte sie ihre Ehre verloren.
Damit war das Nähkästchen, in dem man alles für die Handarbeiten aufbewahrte der sicherste Ort, die kleinen Geheimnisse der Frau zu verstecken. Das wohl bekannteste Beispiel war wohl der Schriftsteller Heinrich Theodor Fontane ( 1819-1898 ). Fontane schreibt im Roman „Effi Briest“, daß sie einen Baron heiratet. Während dieser auf Dienstreisen ist geht sie eine Liebschaft mit einem Offizier ein. Der Baron tötet im Duell den Offizier und verstößt Effi Briest. Auf die Liaison kommt der Baron, als er die versteckten Liebesbriefe nach Jahren im Nähkästchen findet. Der Baron tötet im Duell den Offizier und verstößt Effi Briest.
Bedeutung: Man verrät ein Geheimnis.
Herkunft: Früher war alles so ausgelegt, daß es für die männliche oder weibliche „Rolle“ ausgelegt war. Der Mann ging arbeiten, die Frau blieb zu Hause und sorgte für das Heim, die Küche und die Kinder. Während die „ungeschickte“ Frau niemals etwas im Haus reparierte (die „Aufgabe“ des Mannes) interessierte den Mann nicht die Küche und die Handarbeiten der Frau. Den Mann interessiert das Nähkästchen der Frau ebenso wenig, wie der Frau der Werkzeugkasten des Mannes. Der Unterschied: Betrog der Mann die Frau war das normal - nur wieder ein Zeichen dafür, was für ein toller "Hecht" der Mann war. Betrog aber die Frau den Mann hatte sie ihre Ehre verloren.
Damit war das Nähkästchen, in dem man alles für die Handarbeiten aufbewahrte der sicherste Ort, die kleinen Geheimnisse der Frau zu verstecken. Das wohl bekannteste Beispiel war wohl der Schriftsteller Heinrich Theodor Fontane ( 1819-1898 ). Fontane schreibt im Roman „Effi Briest“, daß sie einen Baron heiratet. Während dieser auf Dienstreisen ist geht sie eine Liebschaft mit einem Offizier ein. Der Baron tötet im Duell den Offizier und verstößt Effi Briest. Auf die Liaison kommt der Baron, als er die versteckten Liebesbriefe nach Jahren im Nähkästchen findet. Der Baron tötet im Duell den Offizier und verstößt Effi Briest.