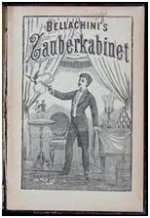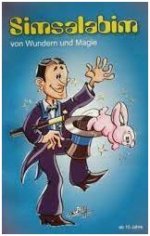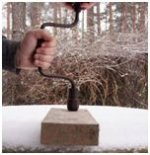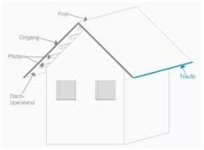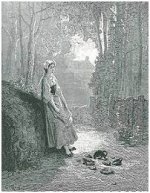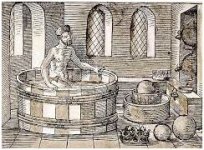raptor230961
Well-known member
- 24 Juli 2016
- 4.947
- 6.736
„Einen Kloß im Hals haben“
Vor lauter Gefühlen, zum Beispiel vor Aufregung, Angst, Schmerz oder Rührung, nicht sprechen, atmen oder singen können. Dabei spricht man oft von einem „Kloß im Hals“ – von einem würgenden Gefühl, das man empfindet, wenn man unter psychischem Druck steht. Dieses ähnelt der Empfindung, die man hat, wenn man etwas verschluckt hat, das nicht gut genug gekaut war – eben als hätte man einen ganzen Kloß verschluckt. Warum dieses würgende Gefühl bei Angst oder Trauer entsteht, konnten Ärzte bisher nicht herausfinden.
Vor lauter Gefühlen, zum Beispiel vor Aufregung, Angst, Schmerz oder Rührung, nicht sprechen, atmen oder singen können. Dabei spricht man oft von einem „Kloß im Hals“ – von einem würgenden Gefühl, das man empfindet, wenn man unter psychischem Druck steht. Dieses ähnelt der Empfindung, die man hat, wenn man etwas verschluckt hat, das nicht gut genug gekaut war – eben als hätte man einen ganzen Kloß verschluckt. Warum dieses würgende Gefühl bei Angst oder Trauer entsteht, konnten Ärzte bisher nicht herausfinden.