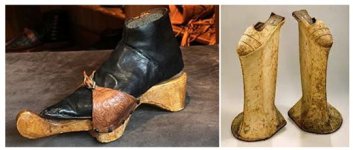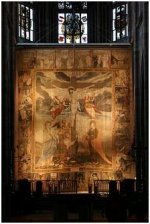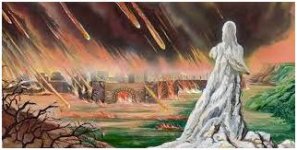raptor230961
Well-known member
- 24 Juli 2016
- 4.947
- 6.728
„Aus dem letzten Loch pfeifen“
Bedeutung:Wer "aus dem letzten Loch pfeift", ist er am Ende seiner Kräfte.
Herkunft:
Der Ausspruch bezieht sich auf die Löcher eines
 Blasinstruments, zum Beispiel einer Flöte. Wenn man auf dem letzten Loch bläst, erklingt der höchste Ton, den das Instrument spielen kann. Nach dem Blasen des letzten Lochs, sind die Möglichkeiten des Instruments erschöpft: Es kann kein höherer Ton hervorgebracht werden.
Blasinstruments, zum Beispiel einer Flöte. Wenn man auf dem letzten Loch bläst, erklingt der höchste Ton, den das Instrument spielen kann. Nach dem Blasen des letzten Lochs, sind die Möglichkeiten des Instruments erschöpft: Es kann kein höherer Ton hervorgebracht werden.