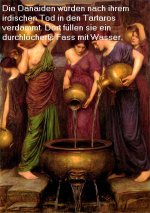Holger1969
Well-known member
- 7 April 2023
- 132
- 45
„Wie im Elysium sein“
Bedeutung: Sehr glücklich sein, in Hochstimmung sein.
Herkunft: Diese Redewendung stammt aus der griechischen Mythologie. Der Begriff "Elysium" ist die lateinische Form von "Elysion", das Gefilde der Seligen, wo (nach Homer) ewiger Frühling herrscht.
Die Verwendung als Redensart ist äußerst selten und dürfte aus der "Zauberflöte" von W. A. Mozart stammen:
"Ein Mädchen oder Weibchen / Wünscht Papageno sich! / O so ein sanftes Täubchen / Wär' Seligkeit für mich! – / Dann schmeckte mir Trinken und Essen; / Dann könnt' ich mit Fürsten mich messen, / Des Lebens als Weiser mich freu'n, / Und wie im Elysium seyn". Der Text der Oper, die 1791 uraufgeführt wurde, stammt von Johann Emanuel Schikaneder